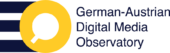Die Rentenversicherung ist weiterhin zahlungsfähig. Zwar gibt sie regelmäßig hohe Summen für sogenannte versicherungsfremde Leistungen aus. Doch diese werden ebenfalls für Rentenansprüche verwendet, etwa für die von Müttern, Frührentnern oder politisch Verfolgten in der DDR. Dies wird zu einem größeren Teil aus Steuern und zum Teil aus den Rentenbeiträgen bezahlt. Falsch ist, dass aktuell unter CDU und SPD 900 Milliarden Euro dafür verwendet werden.
Es gibt keinen Beleg dafür, dass die Rentenversicherung derzeit insolvent ist. Im November 2024 sagte Alexander Gunkel, der damalige alternierende Vorsitzende der Deutschen Rentenversicherung (DRV), laut «Frankfurter Rundschau»: «Die DRV steht nicht vor dem Kollaps.» Er habe allerdings vor Finanzierungsproblemen schon 2027 gewarnt – sollte sich die neue Bundesregierung nicht schnellstmöglich mit der Rentenproblematik beschäftigen. Auch in einer Rede im Dezember 2024 bekräftigte Gunkel, dass die DRV «zuverlässig die Renten zahlen» werde, mahnte aber eine verlässliche Finanzierung an.
Es ist falsch, dass die aktuelle Regierung von CDU und SPD 900 Milliarden Euro für andere Zwecke aus der Rentenkasse entnommen haben. Summen um 900 Milliarden oder eine Billion Euro kursieren immer wieder als angebliche Kosten der sogenannten «versicherungsfremden Leistungen» – allerdings als Schätzung eines Rentenexperten für die Gesamtkosten zwischen 1957 und 2020, also über mehr als 60 Jahre hinweg.
Versicherungsfremde Leistungen werden von der Rentenversicherung als die «nicht beitragsgedeckten Leistungen» bezeichnet. Das bedeutet: Es werden Rentenleistungen ausgezahlt an Menschen, die für diesen speziellen Rentenanspruch zuvor keine oder nur teilweise Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben – es sind also streng genommen keine Versicherungsleistungen.
Fremdleistungen zahlen Renten etwa für Mütter oder SED-Opfer
Dazu gehören unter anderem folgende Fälle (PDF, S. 118): Rentenansprüche für Zeiten von Kindererziehung (sogenannte Mütterrenten) oder Zeiten der Berufsausbildung sowie Frührenten wegen Arbeitslosigkeit oder Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. Auch sogenannte Kriegsfolgelasten etwa Rentenansprüche für Vertriebene des Zweiten Weltkriegs oder Kriegsgefangene sind versicherungsfremde Leistungen. Ebenso Rentenansprüche von Opfern des SED-Regimes oder Auffüllbeiträge für frühere DDR-Renten.
Mit den nicht beitragsgedeckten Leistungen soll also ein sozialer Ausgleich geschaffen werden: Sie zahlen oder verbessern die Renten bestimmter Gruppen in Deutschland, die als unterstützungswürdig betrachtet werden – was sich je nach politischen Mehrheiten über die Jahre auch ändern kann.
Es ist also irreführend bis falsch, es so darzustellen, als würde das Geld gänzlich zweckentfremdet verwendet – etwa ins Ausland fließen, für andere Politikbereiche verwendet oder «das eigene Rentenkonto» von Politikern füllen. Auch ist davon auszugehen, dass ein Teil der Menschen, die Rentenansprüche auf nicht beitragsgedeckte Leistungen haben, selbst Beitragszahler sind – zum Beispiel Mütter, die später gearbeitet haben, oder Frührentner.
Kaum exakte Zahlen bekannt, Kritik vom Bundesrechnungshof
Exakte Zahlenangaben zur Höhe der versicherungsfremden Leistungen existieren kaum. Der Grund dafür: Was genau zu den versicherungsfremden Leistungen zählt, ist umstritten. «Hierfür gibt es jedoch keine allgemein anerkannte Definition, so dass viele Größen geschätzt werden müssen», teilte die Deutsche Rentenversicherung auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.
Auch der Bundesrechnungshof verweist in einem Bericht zur finanziellen Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung auf die umstrittene Definition der versicherungsfremden Leistungen. Um mehr Transparenz zu schaffen, empfiehlt der Rechnungshof regelmäßige Erhebungen und Veröffentlichungen.
Ein Beispiel: Besonders die Größenordnung eines Teils von Rentenansprüchen, die im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung stehen, und ein Teil der Hinterbliebenenrenten sind umstritten. «Der Unterschied dürfte im zweistelligen Milliardenbereich liegen. Genaue Berechnungen dazu liegen jedoch nicht vor», schreibt der Bundesrechnungshof. Es so darzustellen, als könne man die Höhe der aufsummierten nicht beitragsgedeckten Leistungen klar benennen, ist also irreführend.
Die versicherungsfremden Leistungen erfüllen eine gesamtstaatliche Aufgabe – den sozialen Ausgleich. Daher wird ein Teil davon über den Bundeszuschuss an die Deutsche Rentenversicherung gedeckt, also über Steuergeld. Allerdings nicht komplett: So hat die Rentenversicherung geschätzt, dass sie im Jahr 2020 bis zu 112,4 Milliarden Euro für nicht betragsgedeckte Leistungen ausgegeben hat. Die Bundeszuschüsse betrugen in diesem Jahr 75,3 Milliarden Euro, wobei diese nicht allein für versicherungsfremde Leistungen gedacht sind.
Streit um Fremdleistungen ist Jahrzehnte alt
Das bedeutet: Ein Teil der versicherungsfremden Leistungen wird von den Rentenbeiträgen bezahlt. Im Jahr 2020 waren das 37,1 Milliarden Euro, also ein Drittel der Leistungen. Dies ist seit Jahrzehnten ein politischer Streitpunkt und erntet viel Kritik. Oft lautet das Hauptargument: Der Staat sollte zahlen, was zu seinen Aufgaben gehört, nicht die Rentenbeitragszahler.
Würden die versicherungsfremden Leistungen vollständig über die Steuer finanziert, wären Selbständige, Beamte und Abgeordnete stärker belastet, als wenn ein Teil aus den Rentenbeiträgen der abhängig Beschäftigten finanziert wird. Daher fordern etwa auch Gewerkschaften oder Sozialverbände, dass der Bundeszuschuss die nicht beitragsgedeckten Leistungen komplett finanzieren sollte. Auch der Bundesrechnungshof empfahl 2022: «Die Bundeszuschüsse sollen u. a. versicherungsfremde Leistungen pauschal abdecken.»
Gerichte betrachten Fremdleistungen als rechtmäßig
Die Rechtmäßigkeit der versicherungsfremden Leistungen hat immer wieder auch Gerichte beschäftigt: Im Januar 1999 etwa wies das Bundessozialgericht in einem Grundsatzurteil eine Klage gegen die versicherungsfremden Leistungen ab. Die Kasseler Richter argumentierten, der Bund habe das Recht, mit «konkurrierender Gesetzgebung» verschiedene Fremdleistungen dem Rentenversicherungssystem aufzubürden. Voraussetzung sei entsprechend eines älteren Urteils des Bundesverfassungsgerichtes, dass die zusätzlichen Leistungen sozialen Zwecken dienten.
Auch eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts hatte im Dezember 1999 keinen Erfolg. An der Rechtmäßigkeit der nicht beitragsgedeckten Leistungen gibt es also nach aktuellem Stand keine ernsthaften juristischen Zweifel.
(Stand: 30.6.2025)